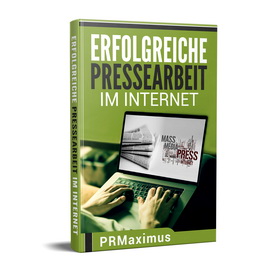29.08.2014 13:37 Uhr in Medien & Presse von Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln
Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen: Die Ökonomik des (Nicht-)Wählens
Kurzfassung: Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen: Die Ökonomik des (Nicht-)WählensIn der Rubrik "Ordnung der Wirtschaft" analysieren die IW-Wissenschaftlerinnen Mara Ewers und Marie Möll ...
[Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln - 29.08.2014] Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen: Die Ökonomik des (Nicht-)Wählens
In der Rubrik "Ordnung der Wirtschaft" analysieren die IW-Wissenschaftlerinnen Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie die Wahlbeteiligung erhöht werden könnte.
In Deutschland sinkt die Wahlbeteiligung. Außerdem beteiligen sich bestimmte Gruppen, etwa junge Menschen, seltener als andere. Wie lässt sich der Zuspruch erhöhen, wenn doch der Einzelne kaum Einfluss auf das Ergebnis hat?
An diesem Wochenende wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt, die Wahlen in Thüringen und Brandenburg folgen zwei Wochen später am 14.September. Es ist nun fast 25 Jahre her, seit die Bürger der ehemaligen DDR mit Parolen wie "Wir sind das Volk" und "Demokratie statt Diktatur" auf die Straße gingen. Ein echtes Wahlrecht war damals eine der Kernforderungen. Brandbeschleuniger dafür waren nicht zuletzt Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen im Mai 1989. Umso erstaunlicher ist deshalb, dass die Wahlbeteiligung in den drei Ländern bei den vergangenen Landtagswahlen wieder deutlich gesunken ist: Im Jahr 2009 lag sie in Sachsen nur bei 52 Prozent und in Thüringen bei 56 Prozent. Eine erfreuliche Ausnahme stellte Brandenburg mit 67 Prozent Beteiligung dar, im Jahr 2004 waren es dort jedoch nur 56 Prozent. Kurz nach der Wiedervereinigung gingen in den drei Bundesländern bei Landtagswahlen durchschnittlich immerhin noch 72 Prozent der Wahlberechtigten wählen.
Auch bei den Bundestagswahlen 2009 und 2013 war die Wahlbeteiligung mit rund 71 Prozent deutschlandweit so gering wie nie zuvor. In den siebziger Jahren hatten noch 91 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Sicherlich auch, weil sich die Wahlkampfthemen verändert haben: Es stehen nicht mehr die großen gesellschaftlichen Fragen wie Ostpolitik, Notstandsgesetze oder Nato-Doppelbeschluss zur Debatte. Während der Wähler 1976 noch vor die Entscheidung "Freiheit statt Sozialismus" - so lautete der Wahlkampfslogan der CDU - gestellt wurde, geht es heute dagegen um individuelle Fördermaßnahmen für wichtige Wählergruppen, wie die Rente mit 63 oder die Mütterrente.
Wissenschaftlich ist nicht eindeutig zu klären, ob zuerst die Wahlbeteiligung der jungen Bürger nachgelassen hat oder ob die Politik zuerst damit anfing, Wahlgeschenke für Ältere, wie die Rente mit 63 - in einem Kommentar in dieser Zeitung so treffend als drohende "Frühverrentung von vielen bestens ausgebildeten Facharbeitern" bezeichnet -, umzusetzen. Es fällt allerdings auf, dass jene Bevölkerungsgruppen, denen die jüngsten politischen Maßnahmen vornehmlich zugutekommen, einen immer größer werdenden Anteil der potentiellen Wähler ausmachen: Die Bürger ab 60 Jahren stellen schon heute mehr als ein Drittel aller 61,9 Millionen Wahlberechtigten. Im Gegensatz dazu sind die unter 30-Jährigen mit 9,8 Millionen Wahlberechtigten eine weniger als halb so große Gruppe. Außerdem ist die Generation "60 plus" viel wahlfreudiger, als es die Jüngeren sind.
Die Statistik zeigt außerdem, dass Wahlberechtigte aus den neuen Bundesländern, bildungs- und einkommensschwache Haushalte, Singles sowie Bürger mit Migrationshintergrund - hier vor allem Frauen - seltener ihre Stimme abgeben. Gewiss: Im Vergleich zu anderen Beteiligungsformen, wie zum Beispiel Volksbegehren oder Bürgerbeteiligung, sind Wahlen noch am geringsten sozial verzerrt und damit ein recht verlässliches Instrument, um eine Teilhabe aller sozialen Gruppen zu gewährleisten. Und doch sinkt die Wahlbeteiligung dieser Gruppen stetig, wodurch die Politik zunehmend weniger von diesen beeinflusst wird. Das führt zu einem immer stärker verzerrten Bild von den Präferenzen der Bürger und könnte eine Spirale des Nichtwählens auslösen. Denn da die ältere Generation ihre Interessen gegenüber der Politik schon jetzt besser zum Ausdruck bringen und durchsetzen kann, wird der demographische Wandel diesen Trend noch verstärken: Wenn es zur Wiederwahl zukünftig ausreicht, dass nur die über 60-Jährigen zufriedengestellt werden, steigt die Politikverdrossenheit bei den unterrepräsentierten Gruppen umso mehr, und die Zahl der Nichtwähler könnte zunehmen.
Politische Konsequenzen tragen alle Bürger. Bei denjenigen, die sich nicht beteiligen, verstärkt sich dann das Gefühl, dass "die da oben" ohnehin machen, was sie wollen. Bei direktdemokratischen Verfahren ist diese soziale Unwucht noch spürbarer, da sozial Schwächere hierbei besonders schwer zur Beteiligung motiviert werden können. Dieses Problem zeigte sich beim Hamburger Volksentscheid zur Primarschule: Besonders sozial schwächere Familien hätten von einer Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre profitiert, beteiligten sich allerdings zu weniger als 20 Prozent.
Diese Entwicklung ist fatal, da die Weichenstellungen, die auf Wahlen folgen, häufig noch Jahrzehnte das Leben der jüngeren Generation betreffen. So sollte beispielsweise der Rentenbeitragssatz Anfang des Jahres von 18,9 auf 18,3 Prozent gesenkt werden. Nun aber können Mütterrente und abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren nur mit höheren Beitragssätzen finanziert werden. Um die Rentenkasse vor den roten Zahlen zu bewahren, müsste nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums spätestens in fünf Jahren der Beitragssatz auf 19,7 Prozent steigen.
Welch eine dramatische Konsequenz das Nichtwählen haben kann, zeigt auch das Schweizer Votum für eine Begrenzung der Zuwanderung. Dieses wurde im März 2014 von lediglich 28 Prozent der Schweizer Wahlberechtigten durchgesetzt. Mit den härteren Vorschriften für die Zuwanderung müssen nun aber alle Schweizer leben. Basierend auf den Umfragen im Vorfeld, hätte eine höhere Beteiligung vermutlich dazu geführt, dass die schärferen Bestimmungen abgelehnt worden wären.
Aus Sicht des amerikanischen Politikwissenschaftlers und Ökonomen Anthony Downs handelten diejenigen Schweizer, die sich den Weg zum Wahllokal gespart haben, vollkommen rational. Schuld daran ist das Dilemma zwischen individueller und kollektiver Rationalität: Für jeden Einzelnen ist der Gang zur Urne nämlich irrational, da der Einfluss einer einzelnen Stimme auf das Wahlergebnis marginal ist. Aus gesellschaftlicher Sicht wäre eine hohe Beteiligung aber wünschenswert. Als Mitbegründer der neuen politischen Ökonomie war Downs einer der Ersten, die das Modell des Homo oeconomicus auf den Wähler übertragen haben. Nach seiner Theorie ist Wählen irrational, denn dem geringen instrumentellen Nutzen der Stimmabgabe stehen Kosten beispielsweise in Form von Zeit gegenüber. Diese sind normalerweise größer als der Nutzen, da die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, die Wahl mit der eigenen Stimme zu beeinflussen. Die Versuche, das Phänomen der positiven Wahlbeteiligung mit Hilfe des Downsschen Modells zu erklären, scheiterten. Theorien außerhalb dieses engen ökonomischen Rahmens erklären die Stimmabgabe indes damit, dass Menschen nicht wählen, um das Ergebnis zu beeinflussen, sondern der Stimmabgabe an sich einen Wert beimessen. Sie wählen um des guten Gefühls willen, ihre Bürgerpflicht erfüllt zu haben. Wählen ist das Bekenntnis zur Gemeinschaft. Oder sie wählen, um ihre Meinung kundzutun. Dies kann verglichen werden mit dem Jubeln vor dem Fernseher bei einem Fußballspiel und ist als "Theorie des expressiven Wählens" bekannt.
Wenn die intrinsische Motivation, also die innere Antriebskraft, die Bürgerpflicht erfüllen zu wollen, mit der Wertigkeit der Wahl zunimmt, könnte erklärt werden, weshalb die Beteiligungsraten bei Bundestagswahlen höher sind als bei Landtagswahlen und diese wiederum höher als bei Kommunalwahlen. Darüber hinaus sind bei der Frage, ob man wählen gehen werde, die Kosten weniger relevant als die sozialen Normen, an die man sich halten möchte.
Dass es beim Gang ins Wahllokal auch um soziale Anerkennung geht, belegt eine neue empirische Studie von Verhaltensökonomen um Stefano DellaVigna aus Berkeley. Durch das Nichtwählen könnte eine Person befürchten, dass ihr eigenes soziales Image Schaden nimmt, beispielsweise wenn man im Nachhinein gefragt wird, ob man gewählt hat. Angenommen, Lügen verursacht psychologische Kosten, wie ein schlechtes Gewissen, dann kann Wählen doch rational sein, nämlich dann, wenn die Kosten des Lügens höher sind als die Kosten des Wählens. Mittlerweile haben zahlreiche Experimente und empirische Studien insbesondere aus der Verhaltensökonomik tatsächlich gezeigt, dass sich der Mensch nicht ausschließlich eigennutzenmaximierend verhält.
Schließlich zeigt folgendes Beispiel, dass sich die rein ökonomischen Theorien der Stimmabgabe aus den fünfziger Jahren von Downs und Kollegen wenig auf die Realität übertragen lassen: Als George W. Bush dadurch gewählt wurde, dass er Florida als entscheidenden Staat mit 437 Stimmen (das waren weniger als 0,01 Prozent der abgegebenen Stimmen im Bundesstaat) für sich gewinnen konnte, gab es nicht den einen "ausschlaggebenden Wähler". Trotzdem wäre es aus heutiger, rückblickender Sicht ein Leichtes gewesen, 500 Al-Gore-Wähler zu mobilisieren, die mit ihren Stimmen die Weltgeschichte verändert hätten.
Wie kann im Hinblick auf solche Fälle die Wahlbeteiligung erhöht werden? Die Einführung einer Wahlpflicht wäre die drastischste Maßnahme. Der SPD-Politiker Jörn Thießen brachte sich mit der Forderung nach einer Wahlpflicht inklusive Bußgeldstrafe, wenn man nicht wählt, nach der Europawahl 2009 kurzzeitig in die Öffentlichkeit. Tatsächlich ist die Stimmabgabe beispielsweise in Australien, Belgien oder der Türkei in unterschiedlicher Ausgestaltung verpflichtend.
Die Einführung einer Wahlpflicht muss aber nicht unbedingt zur Folge haben, dass die Wahlbeteiligung steigt. Es kann zu Verdrängungseffekten kommen, so dass diejenigen, die vorher aus intrinsischer Motivation heraus zur Wahl gingen, nun fernblieben - man kann sich ja quasi durch eine geringe Geldstrafe von seiner Bürgerpflicht freikaufen. Die Verdrängung von innerer Motivation durch die Option des Freikaufens untersuchten die Ökonomen Uri Gneezy und Aldo Rustichini 1998 in zehn privaten Kindergärten in Israel: Zu Beginn der Untersuchung waren die Kindergärten bis 16 Uhr geöffnet, und ein verspätetes Abholen der Kinder wurde nicht sanktioniert. Nach der Einführung einer geringen Strafzahlung stieg die Zahl an verspäteten Abholungen signifikant an. Ein niedriges Bußgeld im Vergleich zu einer Situation ohne Strafe kann also bereits die intrinsische Motivation verdrängen.
Zudem bedeutet eine Wahlpflicht immer eine Einschränkung der Freiheit. Mildere Vorgehensweisen wie die Zusammenlegung von Wahlterminen sind in Deutschland eher üblich. Bei der Europawahl 2014 fanden gleichzeitig in zehn Bundesländern Kommunalwahlen statt. Auch wenn nicht eindeutig bewiesen ist, ob es an der Zusammenlegung lag, ist der Anstieg der Beteiligung bei der Wahl zum Europäischen Parlament um 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2009 beachtlich.
Zudem muss geklärt werden, inwieweit institutionelle Hürden, wie die Registrierung zur Wahl vor der eigentlichen Wahl, die Partizipation reduzieren.
Solch ein Hindernis belastete wohl auch die türkische Präsidentenwahl vor einigen Wochen: In Deutschland lebende Türken durften erstmals hierzulande in Wahllokalen abstimmen. Dazu war es erforderlich, online einen Wahltermin zu beantragen. Diese bürokratische Hürde war sicherlich auch ein Grund dafür, dass nur knapp zehn Prozent der 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken ihre Stimme abgaben.
In den Vereinigten Staaten ist vor jeder Wahl eine Registrierung ins Wählerverzeichnis nötig. Das gilt als eine Ursache für die traditionell niedrige Wahlbeteiligung, die häufig unter 50 Prozent liegt. Gleichzeitig sind amerikanische Forscher besonders daran interessiert, herauszufinden, wie die Beteiligung erhöht werden könnte. Wissenschaftler analysieren das anhand von experimentellen Untersuchungen. Die Ergebnisse finden auch praktische Anwendung im Wahlkampf der Parteien. Für die amerikanischen Forscher ist besonders vorteilhaft, dass die Stimmabgabe in den Vereinigten Staaten genauestens dokumentiert ist. Solche Datengrundlagen ermöglichten es dem Yale-Ökonomen Alan Gerber und dem Politikwissenschaftler Donald P. Green von der Columbia-Universität Ende der neunziger Jahre, erstmals mit Feldexperimenten den Effekt von Anrufen, Postkarten und persönlichen Besuchen auf die Wahlbeteiligung Zehntausender Bürger in New Haven zu messen. Zuvor galten solche Maßnahmen als per se wirksam. Es zeigte sich: Einfache Telefonanrufe brachten keinen messbaren Erfolg, wohingegen persönliche Besuche und Briefe die Wahlbeteiligung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe signifikant erhöhten. Später ergaben weitere Untersuchungen, dass es bei Telefonanrufen auch auf den Anrufer ankommt. Wurden die Bürger von ehrenamtlichen unparteiischen Wahlhelfern angerufen, gingen sie häufiger wählen, als wenn sie von bezahlten Wahlkampagnenhelfern angerufen wurden. Denn den bezahlten Wahlhelfern ging es vornehmlich darum, möglichst viele Personen anzurufen, worunter die Gesprächsqualität litt.
Vor den amerikanischen Präsidentenwahlen 2008 untersuchte der Sozialpsychologe Todd Rogers von der Harvard-Universität, ob die Visualisierung des Wahltages die Bürger zur Registrierung motivieren kann. Dafür wurden rund 300000 Bürger am Telefon befragt, um welche Uhrzeit sie vorhaben, ihre Stimme abzugeben, und welche Aktivitäten sie am Wahltag vor und nach der Stimmabgabe noch planen. Die Idee: Die Vorstellung einer Handlung, hier die Stimmabgabe, führt dazu, dass sie später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wirklich ausgeführt wird. Tatsächlich war die Wahlbeteiligung derjenigen, die befragt wurden, um vier Prozent höher als in einer Kontrollgruppe.
In einem kleinen Experiment zur Europawahl 2014 untersuchten die Autorin-nen dieses Beitrages, ob die Idee der Visualisierung auch in Deutschland funktionieren könnte. Statt Telefonanrufe wurden obige Fragen auf Postkarten gedruckt und an 2500 Haushalte in zufällig ausgewählten Stimmbezirken in Köln verteilt. Nach der Wahl wurde die Wahlbeteiligung in diesen Stimmbezirken mit der Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2009 verglichen. Es gab einen Anstieg in Höhe von 11,3 Prozentpunkten, der zudem höher ausfiel als der Anstieg der Wahlbeteiligung in den anderen Stimmbezirken Kölns, die keine Postkarte erhielten. Da in Deutschland die Stimmabgabe nicht auf den Haushalt genau bestimmt werden kann, musste der Stimmbezirk als Beobachtungseinheit fungieren. Dies beschränkt die Anzahl an Beobachtungen und Aussagekraft natürlich stark. Dennoch ist das Ergebnis ein Indiz dafür, dass Wahlwerbung via Visualisierung funktioniert, und so sind weitere Untersuchungen in diese Richtung wünschenswert. Liegen dazu dann Erkenntnisse vor, können diese genutzt werden, um die unterschiedlichen Formen der Wahlwerbung intelligenter auszugestalten. Darüber hinaus wären keine zusätzlichen Ausgaben nötig: Parteien und Bildungseinrichtungen könnten ihre bestehende Wahlwerbung lediglich modifizieren - basierend auf Studienergebnissen von Psychologen, Sozialwissenschaftlern und Ökonomen.
Mit fundierten Erkenntnissen dieser Forschungsdisziplinen könnte die Spirale des Nichtwählens aufgehalten und der Passivität sozialer Randgruppen entgegengewirkt werden. Während der Untersuchungsschwerpunkt in der Politikwissenschaft eher darauf abzielt, Gründe fürs Nichtwählen zu identifizieren, nähert sich die ökonomische Forschung von der anderen Seite und untersucht, warum Bürger überhaupt wählen gehen. Demnach tun sie das nicht, weil sie versuchen, den Wahlausgang zu beeinflussen, sondern eher, weil sie ihre Bürgerpflicht erfüllen wollen beziehungsweise in ihrem Umfeld einen guten Eindruck wahren möchten. Kampagnen, die darauf abzielen, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sollten also beim Wir-Gefühl ansetzen und an die Eigenverantwortung appellieren.
Dafür sollten Erkenntnisse aus interdisziplinärer Forschung, wie die genannten Experimente, verstärkt genutzt werden. Dann könnte intelligent ausgestaltete Wahlwerbung ohne hohe Zusatzkosten deutlich stärkere Effekte erzielen. Da sich allerdings nicht alle Vorgehensweisen, die beispielsweise in den Vereinigten Staaten üblich sind, einfach so auf Deutschland übertragen lassen, ist hierzulande mehr Forschung auf diesem Gebiet notwendig.
Eines sollte bei alledem indes nicht vergessen werden: Jede Person hat in einer Demokratie natürlich auch das Recht, nicht wählen zu gehen. Die Nichtwähler sollten sich allerdings bewusst sein, welche Konsequenzen ihre Wahlverweigerung haben kann.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln
Konrad-Adenauer-Ufer 21
50459 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 4981-1
Telefax: 0221 4981-533
Mail: presse@iwkoeln.de
URL: www.iwkoeln.de
In der Rubrik "Ordnung der Wirtschaft" analysieren die IW-Wissenschaftlerinnen Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie die Wahlbeteiligung erhöht werden könnte.
In Deutschland sinkt die Wahlbeteiligung. Außerdem beteiligen sich bestimmte Gruppen, etwa junge Menschen, seltener als andere. Wie lässt sich der Zuspruch erhöhen, wenn doch der Einzelne kaum Einfluss auf das Ergebnis hat?
An diesem Wochenende wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt, die Wahlen in Thüringen und Brandenburg folgen zwei Wochen später am 14.September. Es ist nun fast 25 Jahre her, seit die Bürger der ehemaligen DDR mit Parolen wie "Wir sind das Volk" und "Demokratie statt Diktatur" auf die Straße gingen. Ein echtes Wahlrecht war damals eine der Kernforderungen. Brandbeschleuniger dafür waren nicht zuletzt Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen im Mai 1989. Umso erstaunlicher ist deshalb, dass die Wahlbeteiligung in den drei Ländern bei den vergangenen Landtagswahlen wieder deutlich gesunken ist: Im Jahr 2009 lag sie in Sachsen nur bei 52 Prozent und in Thüringen bei 56 Prozent. Eine erfreuliche Ausnahme stellte Brandenburg mit 67 Prozent Beteiligung dar, im Jahr 2004 waren es dort jedoch nur 56 Prozent. Kurz nach der Wiedervereinigung gingen in den drei Bundesländern bei Landtagswahlen durchschnittlich immerhin noch 72 Prozent der Wahlberechtigten wählen.
Auch bei den Bundestagswahlen 2009 und 2013 war die Wahlbeteiligung mit rund 71 Prozent deutschlandweit so gering wie nie zuvor. In den siebziger Jahren hatten noch 91 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Sicherlich auch, weil sich die Wahlkampfthemen verändert haben: Es stehen nicht mehr die großen gesellschaftlichen Fragen wie Ostpolitik, Notstandsgesetze oder Nato-Doppelbeschluss zur Debatte. Während der Wähler 1976 noch vor die Entscheidung "Freiheit statt Sozialismus" - so lautete der Wahlkampfslogan der CDU - gestellt wurde, geht es heute dagegen um individuelle Fördermaßnahmen für wichtige Wählergruppen, wie die Rente mit 63 oder die Mütterrente.
Wissenschaftlich ist nicht eindeutig zu klären, ob zuerst die Wahlbeteiligung der jungen Bürger nachgelassen hat oder ob die Politik zuerst damit anfing, Wahlgeschenke für Ältere, wie die Rente mit 63 - in einem Kommentar in dieser Zeitung so treffend als drohende "Frühverrentung von vielen bestens ausgebildeten Facharbeitern" bezeichnet -, umzusetzen. Es fällt allerdings auf, dass jene Bevölkerungsgruppen, denen die jüngsten politischen Maßnahmen vornehmlich zugutekommen, einen immer größer werdenden Anteil der potentiellen Wähler ausmachen: Die Bürger ab 60 Jahren stellen schon heute mehr als ein Drittel aller 61,9 Millionen Wahlberechtigten. Im Gegensatz dazu sind die unter 30-Jährigen mit 9,8 Millionen Wahlberechtigten eine weniger als halb so große Gruppe. Außerdem ist die Generation "60 plus" viel wahlfreudiger, als es die Jüngeren sind.
Die Statistik zeigt außerdem, dass Wahlberechtigte aus den neuen Bundesländern, bildungs- und einkommensschwache Haushalte, Singles sowie Bürger mit Migrationshintergrund - hier vor allem Frauen - seltener ihre Stimme abgeben. Gewiss: Im Vergleich zu anderen Beteiligungsformen, wie zum Beispiel Volksbegehren oder Bürgerbeteiligung, sind Wahlen noch am geringsten sozial verzerrt und damit ein recht verlässliches Instrument, um eine Teilhabe aller sozialen Gruppen zu gewährleisten. Und doch sinkt die Wahlbeteiligung dieser Gruppen stetig, wodurch die Politik zunehmend weniger von diesen beeinflusst wird. Das führt zu einem immer stärker verzerrten Bild von den Präferenzen der Bürger und könnte eine Spirale des Nichtwählens auslösen. Denn da die ältere Generation ihre Interessen gegenüber der Politik schon jetzt besser zum Ausdruck bringen und durchsetzen kann, wird der demographische Wandel diesen Trend noch verstärken: Wenn es zur Wiederwahl zukünftig ausreicht, dass nur die über 60-Jährigen zufriedengestellt werden, steigt die Politikverdrossenheit bei den unterrepräsentierten Gruppen umso mehr, und die Zahl der Nichtwähler könnte zunehmen.
Politische Konsequenzen tragen alle Bürger. Bei denjenigen, die sich nicht beteiligen, verstärkt sich dann das Gefühl, dass "die da oben" ohnehin machen, was sie wollen. Bei direktdemokratischen Verfahren ist diese soziale Unwucht noch spürbarer, da sozial Schwächere hierbei besonders schwer zur Beteiligung motiviert werden können. Dieses Problem zeigte sich beim Hamburger Volksentscheid zur Primarschule: Besonders sozial schwächere Familien hätten von einer Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre profitiert, beteiligten sich allerdings zu weniger als 20 Prozent.
Diese Entwicklung ist fatal, da die Weichenstellungen, die auf Wahlen folgen, häufig noch Jahrzehnte das Leben der jüngeren Generation betreffen. So sollte beispielsweise der Rentenbeitragssatz Anfang des Jahres von 18,9 auf 18,3 Prozent gesenkt werden. Nun aber können Mütterrente und abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren nur mit höheren Beitragssätzen finanziert werden. Um die Rentenkasse vor den roten Zahlen zu bewahren, müsste nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums spätestens in fünf Jahren der Beitragssatz auf 19,7 Prozent steigen.
Welch eine dramatische Konsequenz das Nichtwählen haben kann, zeigt auch das Schweizer Votum für eine Begrenzung der Zuwanderung. Dieses wurde im März 2014 von lediglich 28 Prozent der Schweizer Wahlberechtigten durchgesetzt. Mit den härteren Vorschriften für die Zuwanderung müssen nun aber alle Schweizer leben. Basierend auf den Umfragen im Vorfeld, hätte eine höhere Beteiligung vermutlich dazu geführt, dass die schärferen Bestimmungen abgelehnt worden wären.
Aus Sicht des amerikanischen Politikwissenschaftlers und Ökonomen Anthony Downs handelten diejenigen Schweizer, die sich den Weg zum Wahllokal gespart haben, vollkommen rational. Schuld daran ist das Dilemma zwischen individueller und kollektiver Rationalität: Für jeden Einzelnen ist der Gang zur Urne nämlich irrational, da der Einfluss einer einzelnen Stimme auf das Wahlergebnis marginal ist. Aus gesellschaftlicher Sicht wäre eine hohe Beteiligung aber wünschenswert. Als Mitbegründer der neuen politischen Ökonomie war Downs einer der Ersten, die das Modell des Homo oeconomicus auf den Wähler übertragen haben. Nach seiner Theorie ist Wählen irrational, denn dem geringen instrumentellen Nutzen der Stimmabgabe stehen Kosten beispielsweise in Form von Zeit gegenüber. Diese sind normalerweise größer als der Nutzen, da die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, die Wahl mit der eigenen Stimme zu beeinflussen. Die Versuche, das Phänomen der positiven Wahlbeteiligung mit Hilfe des Downsschen Modells zu erklären, scheiterten. Theorien außerhalb dieses engen ökonomischen Rahmens erklären die Stimmabgabe indes damit, dass Menschen nicht wählen, um das Ergebnis zu beeinflussen, sondern der Stimmabgabe an sich einen Wert beimessen. Sie wählen um des guten Gefühls willen, ihre Bürgerpflicht erfüllt zu haben. Wählen ist das Bekenntnis zur Gemeinschaft. Oder sie wählen, um ihre Meinung kundzutun. Dies kann verglichen werden mit dem Jubeln vor dem Fernseher bei einem Fußballspiel und ist als "Theorie des expressiven Wählens" bekannt.
Wenn die intrinsische Motivation, also die innere Antriebskraft, die Bürgerpflicht erfüllen zu wollen, mit der Wertigkeit der Wahl zunimmt, könnte erklärt werden, weshalb die Beteiligungsraten bei Bundestagswahlen höher sind als bei Landtagswahlen und diese wiederum höher als bei Kommunalwahlen. Darüber hinaus sind bei der Frage, ob man wählen gehen werde, die Kosten weniger relevant als die sozialen Normen, an die man sich halten möchte.
Dass es beim Gang ins Wahllokal auch um soziale Anerkennung geht, belegt eine neue empirische Studie von Verhaltensökonomen um Stefano DellaVigna aus Berkeley. Durch das Nichtwählen könnte eine Person befürchten, dass ihr eigenes soziales Image Schaden nimmt, beispielsweise wenn man im Nachhinein gefragt wird, ob man gewählt hat. Angenommen, Lügen verursacht psychologische Kosten, wie ein schlechtes Gewissen, dann kann Wählen doch rational sein, nämlich dann, wenn die Kosten des Lügens höher sind als die Kosten des Wählens. Mittlerweile haben zahlreiche Experimente und empirische Studien insbesondere aus der Verhaltensökonomik tatsächlich gezeigt, dass sich der Mensch nicht ausschließlich eigennutzenmaximierend verhält.
Schließlich zeigt folgendes Beispiel, dass sich die rein ökonomischen Theorien der Stimmabgabe aus den fünfziger Jahren von Downs und Kollegen wenig auf die Realität übertragen lassen: Als George W. Bush dadurch gewählt wurde, dass er Florida als entscheidenden Staat mit 437 Stimmen (das waren weniger als 0,01 Prozent der abgegebenen Stimmen im Bundesstaat) für sich gewinnen konnte, gab es nicht den einen "ausschlaggebenden Wähler". Trotzdem wäre es aus heutiger, rückblickender Sicht ein Leichtes gewesen, 500 Al-Gore-Wähler zu mobilisieren, die mit ihren Stimmen die Weltgeschichte verändert hätten.
Wie kann im Hinblick auf solche Fälle die Wahlbeteiligung erhöht werden? Die Einführung einer Wahlpflicht wäre die drastischste Maßnahme. Der SPD-Politiker Jörn Thießen brachte sich mit der Forderung nach einer Wahlpflicht inklusive Bußgeldstrafe, wenn man nicht wählt, nach der Europawahl 2009 kurzzeitig in die Öffentlichkeit. Tatsächlich ist die Stimmabgabe beispielsweise in Australien, Belgien oder der Türkei in unterschiedlicher Ausgestaltung verpflichtend.
Die Einführung einer Wahlpflicht muss aber nicht unbedingt zur Folge haben, dass die Wahlbeteiligung steigt. Es kann zu Verdrängungseffekten kommen, so dass diejenigen, die vorher aus intrinsischer Motivation heraus zur Wahl gingen, nun fernblieben - man kann sich ja quasi durch eine geringe Geldstrafe von seiner Bürgerpflicht freikaufen. Die Verdrängung von innerer Motivation durch die Option des Freikaufens untersuchten die Ökonomen Uri Gneezy und Aldo Rustichini 1998 in zehn privaten Kindergärten in Israel: Zu Beginn der Untersuchung waren die Kindergärten bis 16 Uhr geöffnet, und ein verspätetes Abholen der Kinder wurde nicht sanktioniert. Nach der Einführung einer geringen Strafzahlung stieg die Zahl an verspäteten Abholungen signifikant an. Ein niedriges Bußgeld im Vergleich zu einer Situation ohne Strafe kann also bereits die intrinsische Motivation verdrängen.
Zudem bedeutet eine Wahlpflicht immer eine Einschränkung der Freiheit. Mildere Vorgehensweisen wie die Zusammenlegung von Wahlterminen sind in Deutschland eher üblich. Bei der Europawahl 2014 fanden gleichzeitig in zehn Bundesländern Kommunalwahlen statt. Auch wenn nicht eindeutig bewiesen ist, ob es an der Zusammenlegung lag, ist der Anstieg der Beteiligung bei der Wahl zum Europäischen Parlament um 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2009 beachtlich.
Zudem muss geklärt werden, inwieweit institutionelle Hürden, wie die Registrierung zur Wahl vor der eigentlichen Wahl, die Partizipation reduzieren.
Solch ein Hindernis belastete wohl auch die türkische Präsidentenwahl vor einigen Wochen: In Deutschland lebende Türken durften erstmals hierzulande in Wahllokalen abstimmen. Dazu war es erforderlich, online einen Wahltermin zu beantragen. Diese bürokratische Hürde war sicherlich auch ein Grund dafür, dass nur knapp zehn Prozent der 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken ihre Stimme abgaben.
In den Vereinigten Staaten ist vor jeder Wahl eine Registrierung ins Wählerverzeichnis nötig. Das gilt als eine Ursache für die traditionell niedrige Wahlbeteiligung, die häufig unter 50 Prozent liegt. Gleichzeitig sind amerikanische Forscher besonders daran interessiert, herauszufinden, wie die Beteiligung erhöht werden könnte. Wissenschaftler analysieren das anhand von experimentellen Untersuchungen. Die Ergebnisse finden auch praktische Anwendung im Wahlkampf der Parteien. Für die amerikanischen Forscher ist besonders vorteilhaft, dass die Stimmabgabe in den Vereinigten Staaten genauestens dokumentiert ist. Solche Datengrundlagen ermöglichten es dem Yale-Ökonomen Alan Gerber und dem Politikwissenschaftler Donald P. Green von der Columbia-Universität Ende der neunziger Jahre, erstmals mit Feldexperimenten den Effekt von Anrufen, Postkarten und persönlichen Besuchen auf die Wahlbeteiligung Zehntausender Bürger in New Haven zu messen. Zuvor galten solche Maßnahmen als per se wirksam. Es zeigte sich: Einfache Telefonanrufe brachten keinen messbaren Erfolg, wohingegen persönliche Besuche und Briefe die Wahlbeteiligung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe signifikant erhöhten. Später ergaben weitere Untersuchungen, dass es bei Telefonanrufen auch auf den Anrufer ankommt. Wurden die Bürger von ehrenamtlichen unparteiischen Wahlhelfern angerufen, gingen sie häufiger wählen, als wenn sie von bezahlten Wahlkampagnenhelfern angerufen wurden. Denn den bezahlten Wahlhelfern ging es vornehmlich darum, möglichst viele Personen anzurufen, worunter die Gesprächsqualität litt.
Vor den amerikanischen Präsidentenwahlen 2008 untersuchte der Sozialpsychologe Todd Rogers von der Harvard-Universität, ob die Visualisierung des Wahltages die Bürger zur Registrierung motivieren kann. Dafür wurden rund 300000 Bürger am Telefon befragt, um welche Uhrzeit sie vorhaben, ihre Stimme abzugeben, und welche Aktivitäten sie am Wahltag vor und nach der Stimmabgabe noch planen. Die Idee: Die Vorstellung einer Handlung, hier die Stimmabgabe, führt dazu, dass sie später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wirklich ausgeführt wird. Tatsächlich war die Wahlbeteiligung derjenigen, die befragt wurden, um vier Prozent höher als in einer Kontrollgruppe.
In einem kleinen Experiment zur Europawahl 2014 untersuchten die Autorin-nen dieses Beitrages, ob die Idee der Visualisierung auch in Deutschland funktionieren könnte. Statt Telefonanrufe wurden obige Fragen auf Postkarten gedruckt und an 2500 Haushalte in zufällig ausgewählten Stimmbezirken in Köln verteilt. Nach der Wahl wurde die Wahlbeteiligung in diesen Stimmbezirken mit der Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2009 verglichen. Es gab einen Anstieg in Höhe von 11,3 Prozentpunkten, der zudem höher ausfiel als der Anstieg der Wahlbeteiligung in den anderen Stimmbezirken Kölns, die keine Postkarte erhielten. Da in Deutschland die Stimmabgabe nicht auf den Haushalt genau bestimmt werden kann, musste der Stimmbezirk als Beobachtungseinheit fungieren. Dies beschränkt die Anzahl an Beobachtungen und Aussagekraft natürlich stark. Dennoch ist das Ergebnis ein Indiz dafür, dass Wahlwerbung via Visualisierung funktioniert, und so sind weitere Untersuchungen in diese Richtung wünschenswert. Liegen dazu dann Erkenntnisse vor, können diese genutzt werden, um die unterschiedlichen Formen der Wahlwerbung intelligenter auszugestalten. Darüber hinaus wären keine zusätzlichen Ausgaben nötig: Parteien und Bildungseinrichtungen könnten ihre bestehende Wahlwerbung lediglich modifizieren - basierend auf Studienergebnissen von Psychologen, Sozialwissenschaftlern und Ökonomen.
Mit fundierten Erkenntnissen dieser Forschungsdisziplinen könnte die Spirale des Nichtwählens aufgehalten und der Passivität sozialer Randgruppen entgegengewirkt werden. Während der Untersuchungsschwerpunkt in der Politikwissenschaft eher darauf abzielt, Gründe fürs Nichtwählen zu identifizieren, nähert sich die ökonomische Forschung von der anderen Seite und untersucht, warum Bürger überhaupt wählen gehen. Demnach tun sie das nicht, weil sie versuchen, den Wahlausgang zu beeinflussen, sondern eher, weil sie ihre Bürgerpflicht erfüllen wollen beziehungsweise in ihrem Umfeld einen guten Eindruck wahren möchten. Kampagnen, die darauf abzielen, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sollten also beim Wir-Gefühl ansetzen und an die Eigenverantwortung appellieren.
Dafür sollten Erkenntnisse aus interdisziplinärer Forschung, wie die genannten Experimente, verstärkt genutzt werden. Dann könnte intelligent ausgestaltete Wahlwerbung ohne hohe Zusatzkosten deutlich stärkere Effekte erzielen. Da sich allerdings nicht alle Vorgehensweisen, die beispielsweise in den Vereinigten Staaten üblich sind, einfach so auf Deutschland übertragen lassen, ist hierzulande mehr Forschung auf diesem Gebiet notwendig.
Eines sollte bei alledem indes nicht vergessen werden: Jede Person hat in einer Demokratie natürlich auch das Recht, nicht wählen zu gehen. Die Nichtwähler sollten sich allerdings bewusst sein, welche Konsequenzen ihre Wahlverweigerung haben kann.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln
Konrad-Adenauer-Ufer 21
50459 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 4981-1
Telefax: 0221 4981-533
Mail: presse@iwkoeln.de
URL: www.iwkoeln.de
Weitere Informationen
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln,
, 50459 Köln, Deutschland
Tel.: 0221 4981-1; www.iwkoeln.de
, 50459 Köln, Deutschland
Tel.: 0221 4981-1; www.iwkoeln.de
Weitere Meldungen dieses Unternehmens
10.11.2015 Staat verdrängt Mittelständler
13.10.2015 Weniger statt mehr
23.09.2015 Brexit wird für Briten teuer
Pressefach abonnieren
via RSS-Feed abonnieren
via E-Mail abonnieren
Pressekontakt
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln
50459 Köln
Deutschland
Drucken
Weiterempfehlen
PDF
Schlagworte
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln
50459 Köln
Deutschland
https://www.prmaximus.de/pressefach/institut-der-deutschen-wirtschaft-köln-e.v.-iw-köln-pressefach.html
Die Pressemeldung "Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen: Die Ökonomik des (Nicht-)Wählens" unterliegt dem Urheberrecht.
Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors.
Autor der Pressemeldung "Mara Ewers und Marie Möller in der Frankfurter Allgemeinen: Die Ökonomik des (Nicht-)Wählens" ist Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. IW Köln, vertreten durch .